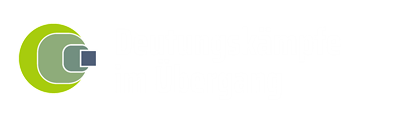Bericht der Podiumsdiskussion „Friedens- und Konfliktforschung in der ‚Zeitenwende‘: Welche Forschung, wie gefördert, wie vermittelt?“
Im Rahmen des AFK-Kolloquiums 2025 diskutierten am 20. März in Landau Vertreter:innen aus Wissenschaft und Forschungsförderung über die Zukunft der Friedens- und Konfliktforschung (FuK). Die Veranstaltung entstand in Kooperation mit den vom BMBF in der Förderlinie „Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung“ geförderten Verbünden Deutungskämpfe im Übergang, TraCe und VesPoTec.
Auf dem Podium sprachen Dr. Thomas Held (Deutsche Stiftung Friedensforschung), Prof. Dr. Jana Hönke (Universität Bayreuth), Dr. Christina Norwig (BMBF) und Prof. Dr. Jonas Wolff (PRIF). Moderiert wurde die Diskussion von Madita Standke-Erdmann (King’s College London/PRIF).

Einigkeit bestand darin, dass Friedens- und Konfliktforschung gerade in Krisenzeiten gesellschaftlich unverzichtbar ist. Zugleich braucht es strukturelle und langfristige Förderung, um wirksam zu bleiben.
Jonas Wolff erläuterte, wie das Forschungszentrum TraCe seine Agenda im Projektverlauf anpassen konnte – etwa durch einen wieder notwendigen stärkeren Fokus auf zwischenstaatliche Kriege und neue Transferformate: „Die thematisch breite Strukturförderung gab uns die Flexibilität, auf politische Entwicklungen zu reagieren – das ist ein großer Vorteil.“
Jana Hönke verwies in dieser Hinsicht darauf, wie die Forschung im bayerischen BMBF-Verbund Deutungskämpfe im Übergang zeitgeschichtliche Perspektiven nutzt für das Verstehen der aktuellen Umbrüche. Sie betonte zudem, dass Friedensforschung immer auch mehr sein müsse als Sicherheitspolitik: „Wir brauchen Räume, um komplexe Gewaltverhältnisse öffentlich zu verhandeln – lokal, historisch informiert und kritisch.“ Sie verwies auf innovative Formate wie die Bayreuth Peace Talks und die Online-Enzyklopädie Rewriting Peace and Conflict (entstanden im Rahmen des ebenfalls BMBF-geförderten Netzwerks „Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict“), die wissenschaftliche Erkenntnisse über Hierarchien, Erinnerungskultur und koloniale Kontinuitäten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
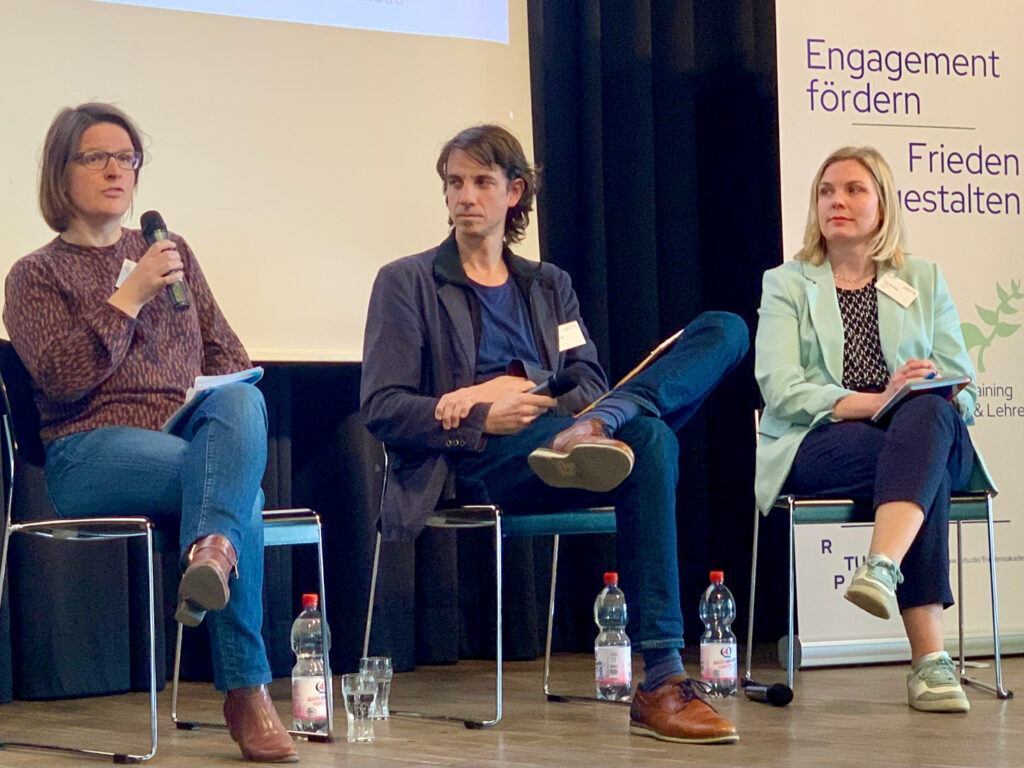
Sowohl Hönke als auch Wolff forderten bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs und eine Förderung, die Vielfalt, kritische Ansätze und langfristige Kooperationen absichert.
Thomas Held (DSF) hob die Rolle der Deutschen Stiftung Friedensforschung als themenoffene Impulsgeberin hervor, verwies aber zugleich auf die Grenzen projektbasierter Förderlogik: „Ohne langfristige Stellen und gesicherte Infrastrukturen kann das aufgebaute Wissen schnell wieder verloren gehen.“
Christina Norwig (BMBF) betonte die Bedeutung der aktuellen Förderlinie zur Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung, die auf Empfehlungen des Wissenschaftsrats basiert und zum Ziel hat, interdisziplinäre Vernetzung, Internationalisierung und nachhaltige Strukturen zu ermöglichen. Sie zeigte sich dankbar für die vielfältigen Impulse aus der Community für die Weiterentwicklung der Forschungsförderung.
In der Diskussion wurde aus dem Publikum heraus unter anderem kritisch beleuchtet, dass manche kleinere Standorte und etablierte, landesweite Strukturen wie die AFK oder ZeFKo bislang zu wenig in der Förderung berücksichtigt würden, und dass die Gefahr bestehe, dass die Friedensorientierung der Forschung zunehmend sicherheitspolitischen Fragen weiche.
Das Podium zeigte: Eine starke, vielfältige und öffentlich präsente Friedens- und Konfliktforschung braucht politische Rückendeckung – und strukturelle Verlässlichkeit.
Quelle: Dieser Veranstaltungsbericht wurde dankenswerterweise von unseren Kolleg*innen bei TraCe erstellt und ist zuerst auf der TraCe-Webseite erschienen.